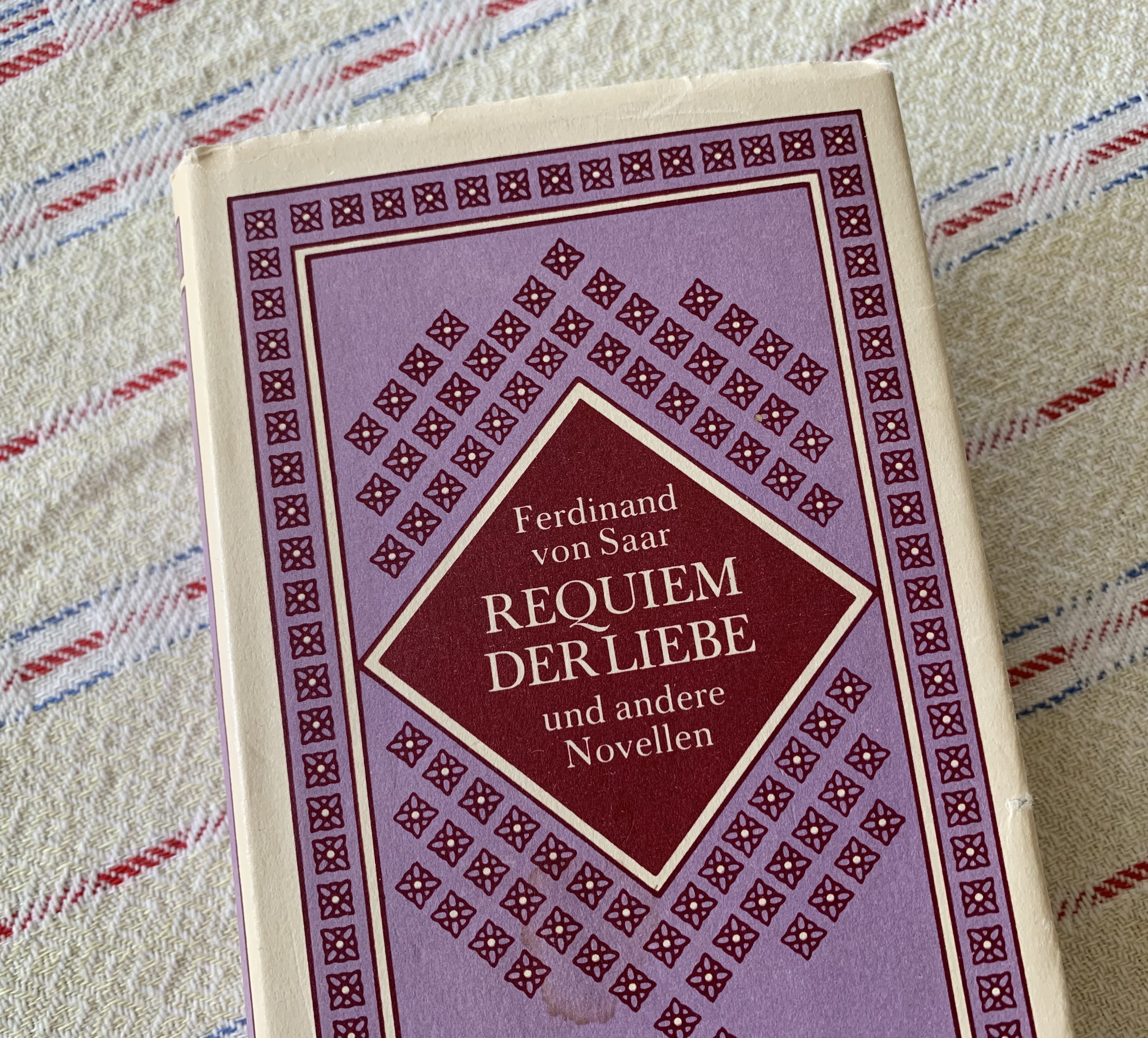Nur drei meiner Bücher hat Dr. Beer lektoriert. Die Arbeit am vierten brach er ab – wie er mir in einem handgeschriebenen Brief mitteilte, ’nach gesundheitlichen Erwägungen‘. Ich weiß es besser. Er schämte sich vor mir – wegen der Ereignisse, die während unserer letzten gemeinsamen Arbeit vorgefallen waren: die Geschichte mit dem Hund.
So beginnt das vom Feuilleton hochgelobte und 2013 vom Kölner Stadt-Anzeiger und dem Literaturhaus Köln im Rahmen der Literaturaktion „Ein Buch für die Stadt“ ausgewählte kleine Werk Idylle mit ertrinkendem Hund (2005) von Michael Köhlmeier, mit dem ich nun definitiv nicht warm geworden bin.
Um was geht es?
Der Autor und Ich-Erzähler telefoniert mit seinem Lektor Dr. Beer, der überraschend ankündigt, ihn zu Hause in Hohenems besuchen zu wollen, damit sie gemeinsam am neuen Buch arbeiten können. Dabei sind sie sich trotz jahrelanger Zusammenarbeit noch immer ziemlich fremd.
Erst wenige Tage vor jenen Geschehnissen hatte er mir das Du-Wort angeboten. Niemals hätte ich damit gerechnet! Ich hätte mir nicht einmal vorstellen können, dass er seine eigene Frau duzte (von deren Existenz – und, bitte, wir kannten uns immerhin seit acht Jahren! – ich damals nichts wusste). Mit Begriffen wie Frau, Freundin, Geliebte oder gar Familie brachte ich diesen Mann nicht in Verbindung; nicht einmal Eltern stellte ich ihm in meiner Einbildung beiseite; ebenso sträubten sich lebensgeschichtliche Kategorien wie Kindheit und Jugend dagegen, sein Leben als ein zum Beispiel mit dem meinen vergleichbares zu beschreiben. Dass ich ihn in Zukunft Johannes nennen sollte, versprach ein Krampf zu werden, ein immer neuer, sich nie entspannender Krampf. (S. 11/12)
Dieser Dr. Beer wird vom Ich-Erzähler zu einer Respekt einflößenden und geheimnisvollen Person verklärt.
Niemand wusste, was er tat, nachdem er seinen Mantel angezogen, den Kragen hochgestellt, den Regenschirm aufgespannt, sich von der Frau beim Eingang verabschiedet hatte und aus dem Verlagsgebäude verschwunden war. Nicht einmal, ob er mit dem Taxi oder dem Bus, der U-Bahn oder dem eigenen Wagen oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad nach Hause wollte. Nach Hause? Wie sah sein Zuhause aus? […] Ich konnte mir allerdings nicht vorstellen, dass dieser Mann Spezies hatte; eben weil ich mir nicht vorstellen wollte, dass er überhaupt ein Privatleben hatte. (S. 15/16)
Ich muss zugeben, bereits an dieser Stelle hätte ich das Büchlein am liebsten zugeklappt, mir war schon jetzt dieser ca. 60-jährige Beer herzlich egal; es kümmerte mich nicht im Geringsten, wie er nach der Arbeit nach Hause kommt und was er dann wohl so tut. Beer selbst bezeichnet sich einmal als Lear’s Narr und somit eignet er sich wohl gut als Projektionsfläche für die Gedanken und Gefühle des Ich-Erzählers.
Der in sprachlichen Fragen stets unerbittliche Lektor bietet ihm also das Du an.
Und nun endlich richtete er sich auf und forderte? Nämlich das Ist-Gleich-Zeichen zwischen unseren Gewichten? Pochte er nun darauf, sich mir preiszugeben? Auf stundenlangen Spaziergängen im Schnee zum Beispiel, die wir – außer Sichtweite eines anderen vernunftbegabten Wesens – beenden würden, indem wir uns umarmten und einer dem anderen dabei mit der Hand an den Hinterkopf griffe, derb genug, um es nicht als ein Streicheln erscheinen zu lassen – zwei Männer in reiferen Jahren mit mehr oder weniger festen Grundsätzen, zwei Freunde. (S. 25)
Als Dr. Beer in Hohenems ankommt, präsentiert ihm Köhlmeier den „Dschungel“ im Wintergarten des Wohnzimmers, die sieben Meter breite, zwei Meter tiefe Kreation seiner Ehefrau Monika, ein wildes Durcheinander von falschen und echten Pflanzen, Tierfiguren, Masken, Totempfählen, Blech und Bildern. Beer verliert völlig die Contenance und schreit, tanzt und singt und betastet die Pflanzen mit geschlossenen Augen. Und das, nachdem sich der Ich-Erzähler doch gerade noch Sorgen gemacht hatte, worüber man sich denn mit dem Gast wohl unterhalten könne.
Monikas Urwald offenbare den Charakter seines Betrachters – ein Freund hatte das einmal gesagt, der hat immerhin sechzehn Jahre lang eine Drogenstation geleitet, ich glaube ihm jedes Wort. (S. 30)
Alle drei sind verlegen, als Dr. Beer wieder auftaucht, und eine echte Annäherung findet auch nach diesem Gefühlsausbruch nicht statt.
Am nächsten Tag unternimmt Dr. Beer einen längeren Spaziergang in der tiefverschneiten Landschaft, auf dem er sich mit einem schwarzen Hund anfreundet, er, der doch bisher so große Angst vor Hunden gehabt hat. Stolz prahlt er mit seiner „Heldentat“, auch in der Gaststätte, in der sie später etwas essen. Das macht den Erzähler unglaublich wütend, denn es sei ein Verrat an ihm und seiner Frau, die diese Geschichte schließlich als Erste gehört hätten.
Bei einem weiteren Spaziergang, auf dem ihn der Erzähler begleitet, treffen sie wieder auf den Hund. Als dieser sie sieht, will er freudig auf sie zulaufen. Dabei bricht er im Eis ein und droht zu ertrinken. Was ist zu tun?
In diese äußere Handlung hinein werden immer wieder Anspielungen und Erinnerungen verwoben, die sich auf den – realen – Tod der Tochter Paula Köhlmeier im Jahre 2003 beziehen. Sie war im Alter von 21 Jahren beim Wandern ganz in der Nähe des Elternhauses abgestürzt.
Die Eltern können seitdem nicht mehr richtig schlafen und nachts treffen sie sich zufällig in der Küche wie Besucher, die aus verschiedenen Ländern angereist sind. Sie gehen täglich zum Grab ihrer Tochter, doch die schwärzeste Zeit der Trauer liegt wohl hinter ihnen, Köhlmeier kann wieder Gitarre spielen, sie freuen sich an den Stimmen der Enkelkinder, treffen ihre Freunde und schreiben.
Spazierengehen stabilisiert uns einigermaßen, von Montag bis Freitag gehen wir jeder für sich allein […] Am Samstag begleitet mich Monika auf meinem, am Sonntag ich sie auf ihrem Weg. (S. 75)
Fazit
Das Buch war so gar nicht meins, und das lag vor allem an der Figur des Dr. Beer, mit dem ich nichts anzufangen wusste. Diese sprachlichen Verrenkungen, als sich die beiden reifen Herren nun auf einmal duzen wollen …
Ich schätzte, er hatte die Folgen der neuen Situation (den Vorschlag, sich von nun an zu duzen) zu wenig berechnet, nämlich dass dem Du ein wenig Praxis nachzuschieben sei, damit es nicht als bare Option wie ein drohender Stalaktit über jedem künftigen Wort hänge, und nun fand er sich in einer noch unangenehmeren Lage. Während ich den Hörer in der Hand hielt, schaute ich zum Fenster hinaus, als könnte ich auf diese Weise dem Aufprall an Intimität ausweichen. (S. 17)
Wenn man sich so fremd ist, warum verspürt dann der Erzähler den Drang, mit genau diesem Fremden über die Schwierigkeit zu sprechen, wie man über den Tod der eigenen Tochter schreiben könnte? Nur, weil Beer ein so unbestechlich strenger Lektor ist, der ihm kein falsch gewähltes Wort durchgehen lässt?
Er legte über einzelne Worte das Chirurgentuch mit dem Schlitz in der Mitte, das den Gegenstand der Untersuchung von allen anderen Organen isoliert, um dessen Bedeutung und, daraus resultierend, dessen Strahlkraft innerhalb eines Satzes und weiter eines Satzgefüges besser untersuchen zu können. Als halte er es für möglich, dass wir uns in verschiedenen Sprachen unterhielten, die nur zufällig gleich klangen. Es war mein Text; ich vertraute ihm, aber nicht mir, dem Verfasser. Ich vertraute meinem Lektor, verlor aber das Vertrauen in meinen Text. (S. 24)
Viele haben das Buch als Köhlmeiers literarische Auseinandersetzung mit dem Verlust der Tochter gelesen. Dabei scheint es mir zunächst viel mehr um die Themen Freundschaft und Distanz zu gehen. Wie sonst ließe sich die Dominanz des Lektors erklären? Letztlich scheitert die Annäherung zwischen den beiden Männern. Köhlmeier ist sich ohnehin unsicher, ob eine neue Freundschaft in ihrem Alter überhaupt eine Option sein kann.
Wenn so etwas in unserem Alter überhaupt noch möglich ist, dann gewiss nicht aus der Jugendkraft der Empfindungen heraus, sondern als eine Entscheidung, als ein gut überlegtes Setzen des Ist-Gleich-Zeichens zwischen den Gewichten. Genauso kompliziert und über die Bande gespielt muss man es ausdrücken. (S. 83)
Eine Freundschaft ist aber auch deshalb nicht möglich, weil sie weder gemeinsam schweigen noch über den Tod Paulas sprechen können. Das entscheidende Gespräch, das sich der Erzähler wünscht, findet nur in den Gedanken Köhlmeiers statt.
‚Wie kann ich über den Tod unserer Tochter schreiben?‘
‚Willst du denn darüber schreiben?‘
‚Das möchte ich, ja.‘
‚Ich denke, ich weiß, wo das Problem liegt. Du bist dir nicht sicher, ob du Literatur machen willst oder bloße Erinnerung, hab ich recht?‘
‚Ich will, dass sie bei mir ist. Und ich habe die Hoffnung, dass sie näher bei mir ist, wenn ich über sie schreibe.‘ … (S. 83 ff.)
Genau das – ein Schreiben über Paula – kann nicht stattfinden. Stattdessen kommt es zu der dramatischen Schlüsselszene, in der der Hund zu ertrinken droht. Auch dort entzieht sich der Lektor; er rennt kopflos davon, um Hilfe zu holen. Der Erzähler bleibt zurück. Verschiedene Lesarten sind denkbar.
Verkörpert Dr. Beer die Unfähigkeit, Trauer und existenzielle Not zu ertragen? Weiß er, dass er den Erzähler im Stich gelassen hat?
Setzt sich der Erzähler so für den Hund ein und begibt sich letztlich sogar in Lebensgefahr, weil er den Gedanken nicht erträgt, ihn sterben zu sehen? Oder hatte er überhaupt nicht vor, sich selbst zu gefährden, und wollte einfach der im Eis eingebrochenen Kreatur zu Hilfe kommen? Ist seine Rettungsaktion eine Entscheidung für das Leben – trotz des entsetzliches Verlusts, den er und seine Frau erlitten haben? Oder symbolisiert der schwarze Hund seine eigene Trauer und Traurigkeit?
Im Kölner Stadt-Anzeiger hat Köhlmeier erklärt: „Dieser einsame, ins Eis eingebrochene Hund spiegelte meine eigene Lebenssituation wider.“
Dann hätte sich der Ich-Erzähler also in seiner Trauer selbst gerettet und aus dem Wasser gezogen, und zwar ohne, dass ihm jemand – wie Dr. Beer – dabei hätte helfen können. Das finde ich gedanklich zwar interessant und bedenkenswert, aber für eine Geschichte zu verkopft. Nicht unmittelbar genug.
Anmerkungen
Hier geht’s lang zur Besprechung auf dem Grauen Sofa und hier schreibt Julia Zarbach auf der Seite des Literaturhauses Wien. Interessant fand ich auch den Artikel von Heike Baller auf ihrem Blog Kölner Leselust.
2005 erschien der Prosaband Maramba von Paula Köhlmeier, herausgegeben von ihren Eltern.
Sehens- und hörenswert sind die Nacherzählungen Köhlmeiers der griechischen Mythen.