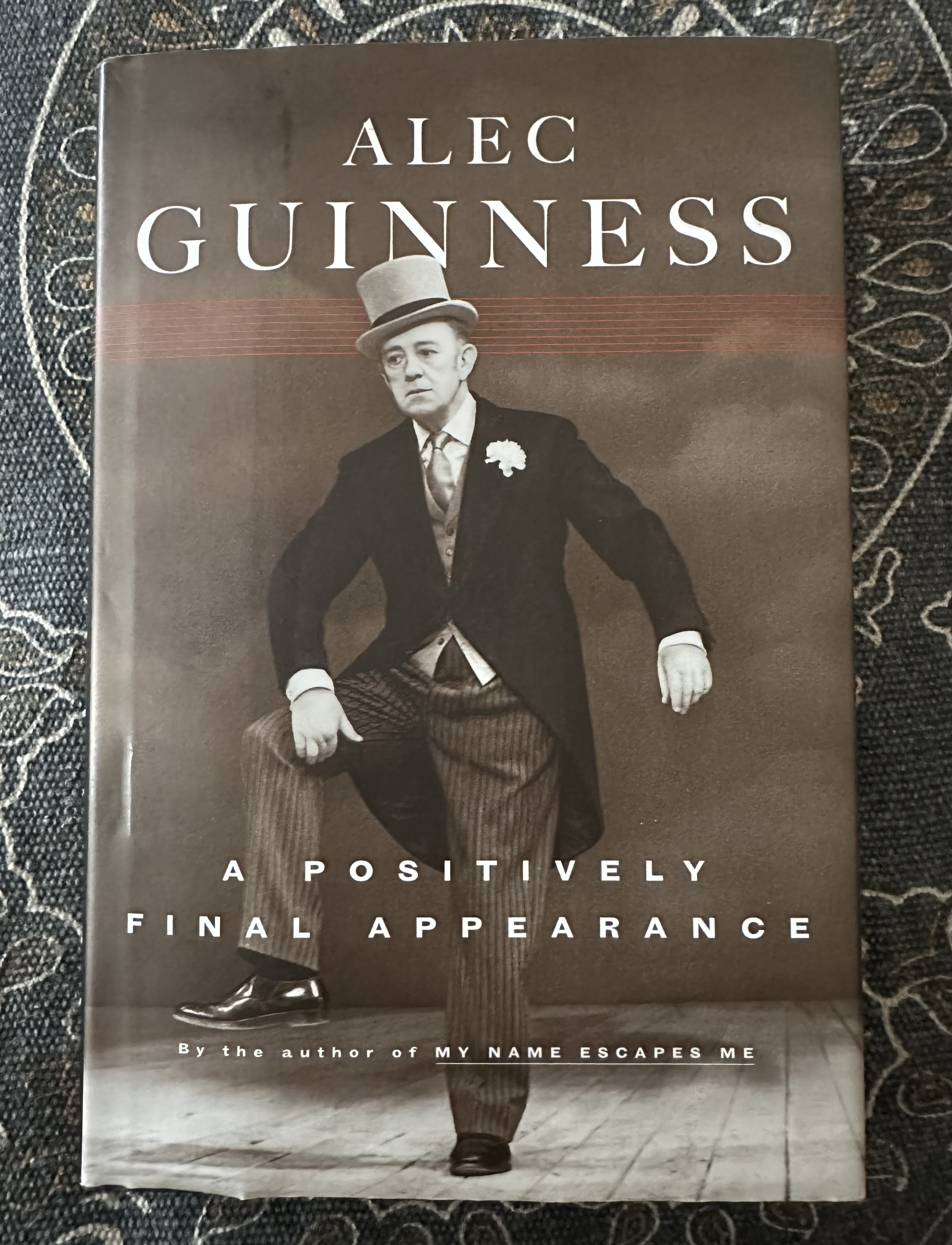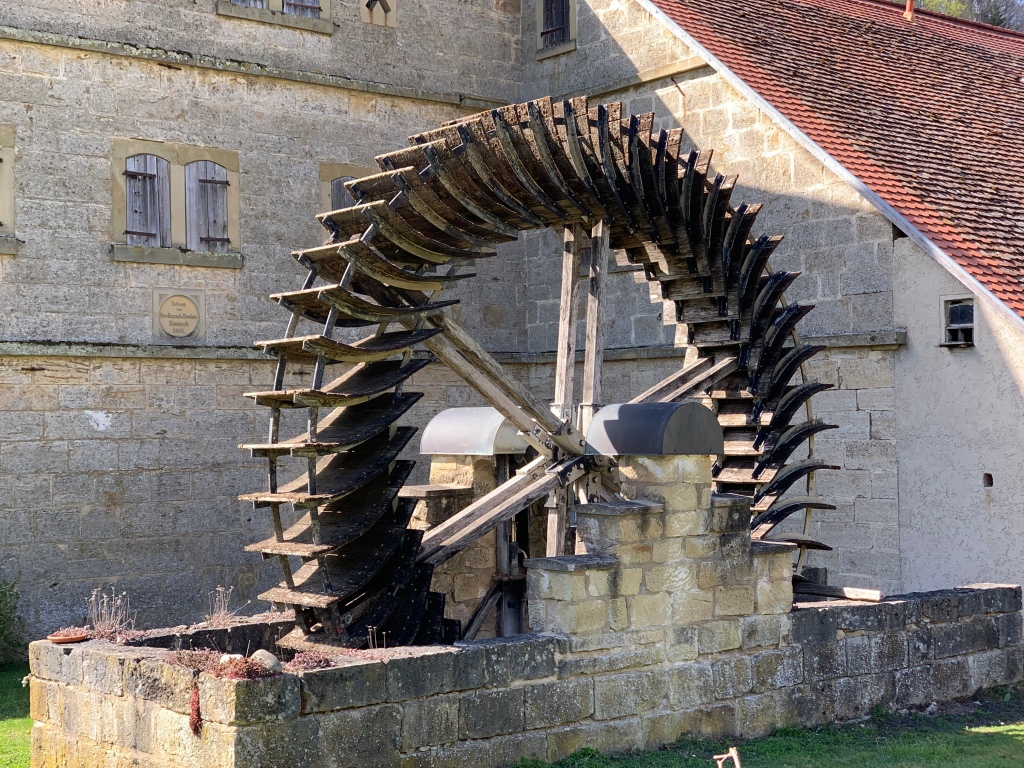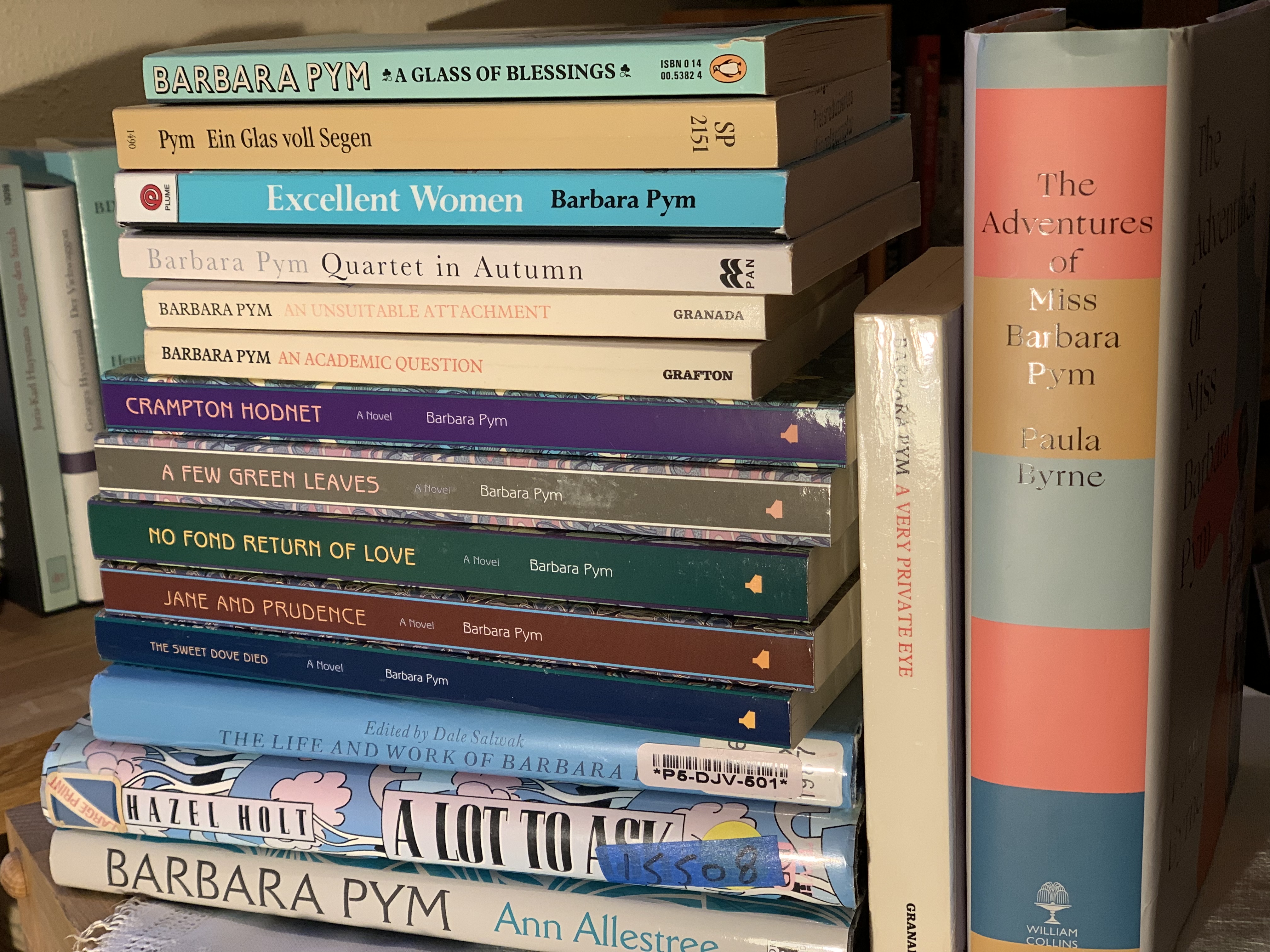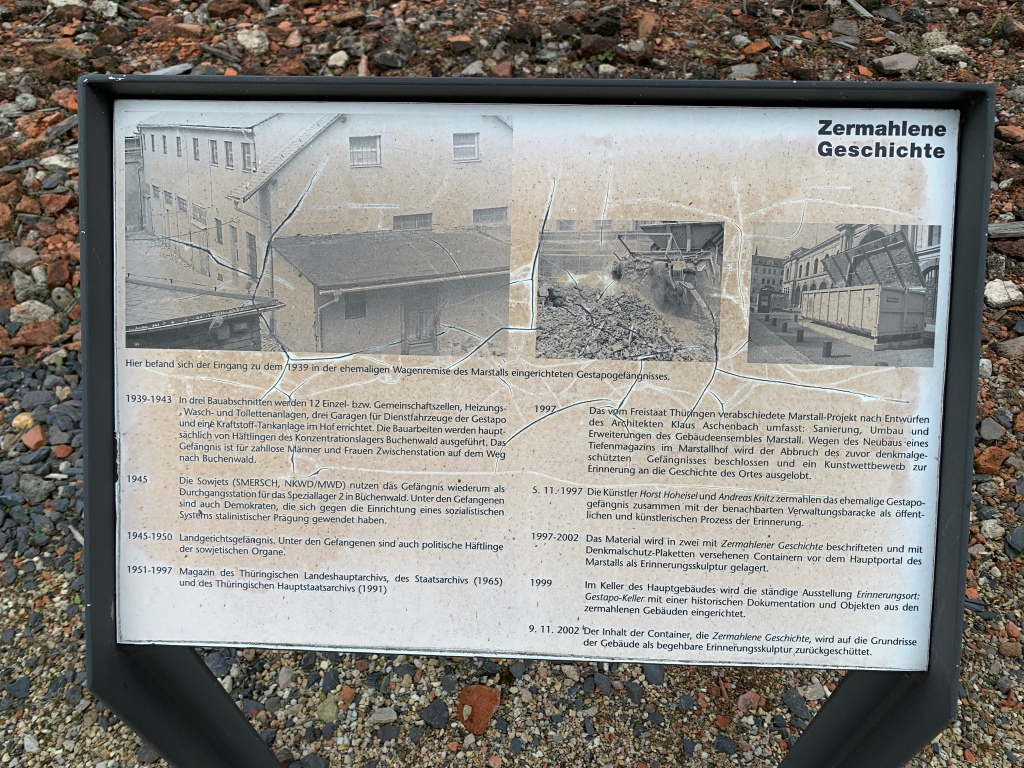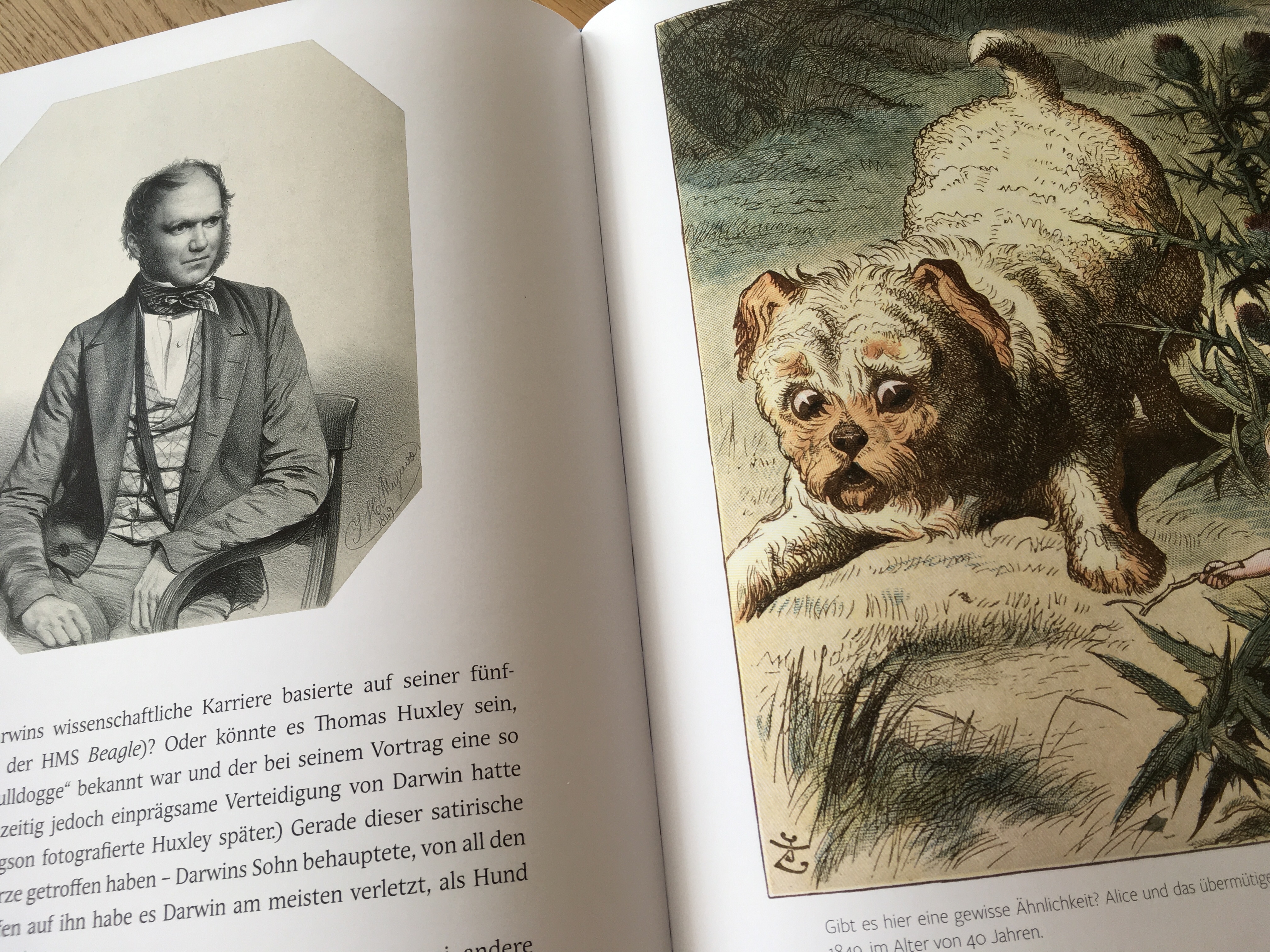Nachdem ich Farewell, my Lovely (1940), den zweiten Roman um den einsamen, trinkfesten und zynischen Privatdetektiv Philip Marlowe von Raymond Chandler (1888 – 1959) gelesen hatte, war klar, dass ich in den nächsten Wochen auch die anderen Marlowe-Krimis wiederlesen muss. Doch heute soll es um Tom Hineys Biografie zu diesem großen Kriminalschriftsteller gehen.
Hiney liefert mit den ca. 300 Seiten seiner Chandler-Biografie einen knackigen und informativen Abriss, bei dem sich der Biograph nicht in den Vordergrund drängelt, bietet doch schon das Leben Chandlers genügend Stoff für mehrere Romane:
Chandler wird 1888 in Amerika geboren, sein Vater ist Alkoholiker, der die Familie früh verlässt. Als Siebenjähriger kehrt er mit seiner mittellosen Mutter zurück in deren Heimat nach Ireland. Verwandte unterstützen sie und ein Onkel finanziert, wenn auch nur mäßig begeistert, schließlich den Besuch der Privatschule Dulwich College in London, deren Direktor A. H. Gilkes einen unauslöschlichen Eindruck auf seine Schüler hinterlässt.
Gilkes‘ relentless sense of integrity could at times be excessive. P. G. Wodehouse, who left Dulwich in the year of Chandler‘s arrival, remembered the Master as the sort of man who would approach him after a good cricket performance and say ‚Fine innings, Wodehouse, but remember we all die in the end.‘ (S. 14)
Ein Studium mag der Onkel dem begabten Neffen dann doch nicht finanzieren. Allerdings unterstützt er längere Auslandsaufenthalte in Deutschland und Frankreich, sodass Raymond beide Sprachen lernt. Das wiederum hilft ihm, neben der Tatsache, dass er die britische Staatsangehörigkeit angenommen hat, 1907 den Einstellungstest für den öffentlichen Dienst als Drittbester von mehreren hundert Kandidaten zu bestehen. Doch in seiner ersten Stelle im Marineministerium hält Chandler es nur ein paar Monate aus; statt solider Tätigkeit im Staatsdienst folgt eine Phase verschiedenster Jobs, z. B. als Journalist, er mag sich nicht unterordnen und langweilt sich schnell. Vergeblich hofft er, als Dichter Anerkennung zu finden.
Chandler‘s early poetry, with few exceptions, is most remarkable for the fact that he managed to have it published – for payment – in reputable magazines. (S. 25)
Sein Onkel, der ihm unmissverständlich klargemacht hat, dass es nun Chandlers Aufgabe sei, sich auch finanziell um seine Mutter Florence zu kümmern, borgt ihm ein letztes Mal Geld und so reist der 24-jährige Chandler 1912 nach Amerika. Während der Schiffsreise lernt er eine der reichsten Familien Los Angeles kennen, was ihm zu weiteren Kontakten und einer kulturellen Anlaufstelle für seine Freizeit verhelfen sollte. Schließlich lässt er seine Mutter nach San Francisco nachkommen, jobbt in allen möglichen Bereichen, belegt erfolgreich einen Kurs in Buchhaltung und arbeitet längere Zeit in der Buchhaltung einer Molkerei. 1913 dann der Umzug nach Los Angeles.
1917 meldet er sich zur Armee und kämpft während des Ersten Weltkrieges auf kanadischer Seite in Europa. Er erlebt, wie er als einziger aus seiner Einheit einen Angriff der Deutschen überlebt. Später wird er sich nur ganz selten zu seinen Kriegserinnerungen äußern. Nach Kriegsende beginnt er eine Affäre mit der 18 Jahre älteren Pearl Eugenie Pascal, die er immer nur Cissy nannte und die sich ihm gegenüber lange 10 Jahre jünger ausgegeben hat, als sie tatsächlich war. Cissy lässt sich für ihn von ihrem zweiten Ehemann scheiden, doch erst als Chandlers Mutter gestorben ist, ist der Weg für die Eheschließung 1924 frei. Die beiden bleiben bis zu Cissys Tod zusammen, sie war sein Halt, sein Idol, selbst seine Affären und sein Alkoholismus, dem Chandler immer nur phasenweise abschwor, änderten daran nichts.
Ab 1922 arbeitet er sich in der rasch florierenden Ölfirma Dabney Oil Syndicate hoch und fängt an, richtig viel Geld zu verdienen. Ab den späten zwanziger Jahren läuft seine Trinkerei völlig aus dem Ruder. Er zieht in ein Hotel, da Cissy seine Affären und seine Sauferei nicht mehr erträgt. Wiederholt droht er mit Selbstmord oder verschwindet mit einer der Sekretärinnen von Dabney‘s übers Wochenende. Danach sind die beiden so durch den Wind, dass schließlich keiner von ihnen vor Mittwoch an der Arbeit erscheint. Er hat die ersten Blackouts und Gedächtnisausfälle.
Though Chandler made scant direct record of, or reference to, these lost years, it was a period in his life on which, in his later books, he would draw more heavily than any other. The age and circumstances of his fictional character, Philip Marlowe, would be very similar to those of Chandler during the last four years of his oil career. Both men were lonely drinkers working in Los Angeles. Both were good at jobs which they found distasteful and both, to some extent, were addicted to physical danger. The unique atmosphere of early 1930s Los Angeles would also figure more strongly in Chandler‘s fiction than that of any other period, for his own instability around 1930 was mirrored by the situation in which LA found itself following the Wall Street Crash of 1929. (S. 64)
Schließlich machen ihn sein ständiges Betrunkensein am Arbeitsplatz und seine daraus entstehenden Fehlzeiten für Dabney untragbar. 1932 wird er gefeuert. Mit seinen Ersparnissen kann er sich und Cissy eine Weile finanziell über Wasser halten, was hilfreich ist, denn ehemalige Freunde hat er mit seinem Verhalten längst vergrault und weder Verwandte noch eine Rückkehr nach Irland sind eine Option.
Nun kommt er – er ist inzwischen gründlich ausgenüchtert – auf die ja nicht unbedingt naheliegende Idee, sein Geld mit kurzen Geschichten verdienen zu wollen, die in preiswerten, auf raschen Konsum ausgerichteten sogenannten Pulp Magazinen veröffentlicht wurden. Das konnten Horror- und Abenteuergeschichten sein, Western oder eben auch Kriminalgeschichten. Diese erschienen ihm – trotz manche Plumpheiten – ehrlicher, aufrichtiger und besser zur Gegenwart passend als die traditionellen britischen Krimis.
Chandler […] was also genuinely intrigued by detective fiction and the likes of Dashiell Hammett and Gardner. American crime fiction had, since the 1920s, been throwing off the polite shackles of the genre‘s English originators. The result was a tough, ‚hard-boiled‘ and instantly popular new sub-genre. It was also a sub-genre that had found, in Black Mask, both a new platform and a mass market. (S. 75)
Sein neues berufliches Ziel geht Chandler methodisch an; er besucht einen Kurs zum Schreiben von Kurzgeschichten, kauft Bücher dazu und analysiert die Geschichten, die in Pulp Magazinen veröffentlicht wurden, z. B. von Erle Stanley Gardner, dem Erfinder von Perry Mason. Doch Chandler feilt von Anfang an länger an seinen Texten, achtet mehr auf die Sprache als seine Kollegen, dafür weniger auf den Plot. 1933 wird seine erste Geschichte Blackmailers don‘t shoot in Black Mask veröffentlicht, an der er fünf Monate gearbeitet hat.
Dennoch ist das Ergebnis zunächst ernüchternd.
It is possible to read the story half a dozen times without understanding what has taken place. This was partly arrogance on Chandler‘s part – his refusal to map out plots was largely because he considered them to be superfluous to the new realistic spirit of detective fiction. […] The plot proved to be a mess, and he was not yet sufficiently good a writer to create characters convincing enough to compensate for this. (S. 81)
Rückblickend sagt er über sein Schreiben, dass er am Anfang kaum in der Lage gewesen sei, einem Protagonisten glaubwürdig den Hut abzusetzen, ja, es habe zwei drei Jahre gedauert, bis er jemanden vernünftig einen Raum habe verlassen lassen können, und noch viel länger, bis er es geschafft habe, eine Szene mit mehreren Figuren im Griff zu behalten.
Writing was, none the less, a form of discipline that the reforming alcoholic enjoyed. Chandler grew fascinated by the mechanics of fiction, and even experimented with the physical process of typing… (S. 72)
Sein Leben lang wird er schmale, gelbe Papierstreifen in seine Schreibmaschine einsetzen, auf denen er nur 12 bis 15 Zeilen tippen kann.
It was a trick, he discovered, which forced him to put ‚a bit of magic‘ on to each small sheet; be it an image, description or wisecrack. (S. 72)
Irgendwann ist er das Zugpferd des Black Mask Magazine, das sich immer stärker auf Detektiv- und Kriminalgeschichten konzentriert. Doch richtig viel Geld läßt sich für Chandler nicht damit verdienen. Seine finanziellen Umstände sind lange ausgesprochen drückend, weil er einfach nicht schnell genug Geschichten nachliefert. Er schreibt mehrere Monate an einem Text, während andere ihre Geschichten zum Teil in nur wenigen Tagen runterschreiben. Auch als er für mehrere Magazine schreibt, die zum Teil wesentlich besser als Black Mask bezahlen, verdient er nicht wirklich gut.
Doch 1938 wendet sich das Blatt. Ein New Yorker Literaturagent zeigt dem Verlagshaus Alfred Knopf einige Geschichten von Chandler. (Hier wird leider die Rolle von Blanche Knopf wieder völlig ignoriert). Jedenfalls teilt Knopf mit, dass er Interesse daran habe, einen Roman von Chandler zu lesen.
Und so erscheint 1939 sein erster Roman The Big Sleep. Wie bei fast allen seinen Kriminalromanen hat er darin mehrere seiner alten Geschichten aus dem Black Mask Magazine recycelt. Doch der Erfolg, auf den Knopf und Chandler gehofft hatten, stellt sich nicht ein. Erst kurz vor der Veröffentlichung des vierten Marlowe-Romans Lady in the Lake 1943 erlaubt Knopf eher resigniert auch Abdrucke in Pulp Magazinen und eine Taschenbuchausgabe. Doch nun passiert, womit keiner mehr gerechnet hat. Alle Marlowe-Bücher verkaufen sich wie geschnitten Brot, selbst die Hardcover-Ausgaben sind auf einmal erfolgreich. Das Problem dabei, Chandler fängt wieder an sich zu langweilen und weiß nicht recht, was er in Zukunft tun will.
Da kommt im Mai 1943 ein Anruf der Paramount Studios. Sie bieten ihm an, zusammen mit Billy Wilder das Drehbuch für die Verfilmung von Double Indemnity nach der Romanvorlage von James M. Cain zu schreiben. Chandler sagt zu.
Just as he had done with the oil business in the 1920s, Chandler was about to enter a booming American industry at the optimum moment. The post-Depression, pre-television 1940s would turn out to be one of Holywood‘s greatest (and richest) decades. This had much to do with the continuing war, which was providing the American movie industry with a captive market, both at home and abroad. (S. 134)
Die enge Zusammenarbeit mit Wilder findet Chandler, nach den langen Jahren der sozialen Isolation, ausgesprochen schwierig. Er fängt wieder an zu trinken und glaubt, dass niemand das bemerkt. Dazu kommen die Probleme mit der Filmzensur, die sich die bekannteren Drehbuchschreiber bei der Romanvorlage von Cain nicht hatten antun wollen. Dennoch wird Double Indemnity ein Riesenerfolg. Chandler wird nun als fester Drehbuchschreiber engagiert und schwimmt in Geld.
Doch spätestens bei der Arbeit am Drehbuch zu The Blue Dahlia wird Chandler wieder zu einem alkoholischen Wrack. Er will die Arbeit zwischenzeitlich nicht mehr fortführen und erpresst von seinen Auftraggebern, die Angst hatten, dass ansonsten das ganze Projekt scheitern würde, schließlich Bedingungen, die noch keinem anderen Schreiber eingeräumt worden waren. Er setzt durch, dass er von zu Hause aus arbeiten kann, ständig zwei Cadillacs vor der Tür stehen, um Manuskripte zum Studio oder ihn oder Cissy zum Arzt zu bringen. Sechs Sekretärinnen würden sich jeweils in Zweierschichten bei der Arbeit ablösen. Auch ein Arzt solle bereitstehen, um ihm Vitaminspritzen zu verabreichen, da Chandler während seiner Trinkexzesse nichts aß. Chandler säuft also, schläft und schreibt. Das Drehbuch wird beendet und The Blue Dahlia wird 1946 zu einem der erfolgreichsten Kinofilme in Großbritannien. Chandler strickt dann eifrig an der Legende, dass er nur das Trinken wieder begonnen habe, um das Projekt zu einem rechtzeitigen Abschluss zu bringen. Die Zensoren bemängeln dann auch die übermäßige Erwähnung alkoholischer Getränke im Drehbuch.
1946 wird er von Paramount gefeuert. Wieder wegen seines Alkoholmissbrauchs und der Tatsache, dass er schlicht nicht mehr zur Arbeit erscheint. Chandler und Cissy ziehen um nach La Jolla, wo sie die nächsten neun Jahre leben werden.
Ab Mitte der vierziger Jahre beginnen Kritiker zunehmend, sich ernsthaft mit den Kriminalromanen um Marlowe zu beschäftigen. Während einige befürchten, dass Chandler der ernsthaften Kultur erheblichen Schaden zufüge, weil er nun auch von intelligenten Leuten gelesen werde, sehen besonders britische Kritiker und Schriftstellerkollegen wie Stephen Spender, J. B. Priestley, William Somerset Maugham und W. H. Auden Chandler nicht länger als Vertreter billiger Unterhaltungsliteratur, sondern als ernstzunehmenden Schriftsteller an, dessen Romane als Kunstwerke gelesen werden müssten. Chandler interessiert das nur mäßig, er hält ohnehin die meisten Kritiker für Menschen, die nicht schreiben können, keinen Kontakt zum Leben der Normalsterblichen hätten und sowieso schon halb tot seien. Und um ihre eigene Daseinsberechtigung nachzuweisen, würden sie ständig Interpretationen liefern, auf die außer ihnen kein vernünftiger Mensch komme. Aber es freut ihn natürlich, dass er anscheinend sein Ziel erreicht hat: aus einem heruntergewirtschafteten Genre etwas Neues geschaffen zu haben, über das sich die Intellektuellen in die Haare kriegen. Seine eigenen Ansichten zur Literatur veröffentlicht er ab Mitte der Vierziger immer wieder auch in Aufsätzen, die beispielsweise in The Atlantic erscheinen.
1949 erscheint Little Sister, sein fünfter Marlowe-Roman.
1950 beginnt die Zusammenarbeit mit Alfred Hitchcock. Sie wollen Strangers on a Train nach dem Roman von Patricia Highsmith verfilmen. Doch Chandler überwirft sich mit Hitchcock, beschimpft ihn als „fetten Bastard“ und wird mal wieder gefeuert.
1953 erscheint The Long Goodbye, sein sechster Roman um Marlowe.
Dann, 1954, die große Katastrophe, von der sich Raymond Chandler nicht mehr erholen sollte. Nach jahrelangem Leiden an einer Lungenfibrose stirbt seine geliebte Cissy im Alter von 84 Jahren, um die er sich in ihren letzten Monaten aufopfernd gekümmert hat.
For thirty years, ten months and four days, she was the light of my life, my whole ambition. Anything I did was just the fire for her to warm her hands at. That is all there is to say. (S. 214)
Mit Cissys Tod geht ihm der letzte Halt verloren. Er schafft es nicht einmal, ihre Asche zu bestatten. Er verkauft sein Haus und Alkoholabstürze, Sanatoriumsaufenthalte, diverse Umzüge, lange Englandaufenthalte und zweifelhafte Versuche, sich mit anderen Frauen und Heiratsanträgen zu trösten, sowie Selbstmordversuche folgen. Seine Freunde versuchen alles, um ihn zu stützen, abzulenken und unternehmen sogar Reisen mit ihm.
Chandler‘s self-control continued to fall away in the loneliness into which he had plunged after Cissy‘s death. He made desperate midnight phone calls to people he had only ever known by letter. He was drinking constantly. (S. 217)
Dennoch schafft es Chandler irgendwie, Playback, seinen letzten Marlowe-Roman fertigzustellen, der 1958, ein Jahr vor seinem Tod erscheint. 1959 stimmt Helga Greene, seine fast 30 Jahre jüngere britische Literaturagentin, seinem Heiratsantrag zu. Chandler besteht darauf, bei ihrem Vater formell um ihre Hand anzuhalten, was dieser ausgesprochen ungnädig aufnimmt. Beleidigt reist er nicht mit Helga zurück nach London, sondern verkriecht sich in La Jolla und trinkt und vernachlässigt sich so lange, bis er mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wird, an der er drei Tage später stirbt. Greene wird damit – nach einem vor einem Gericht ausgetragenen Erbschaftskrieg – seine alleinige Erbin und Nachlassverwalterin.
Es war ein trister, anonymer Tod für einen Mann, der mit seinem Witz und seiner Klarsicht die Literatur so bereichert hatte. Die Zeitungen brachten lange, anerkennende Nachrufe. Die Londoner Times stellte fest: ‚Er gehört mit Sicherheit zu dem knappen Dutzend Kriminalschriftsteller, die zugleich auch Neuerer und Stilisten waren; die, in den gewöhnlichen Erzminen der Kriminalschriftstellererei arbeitend, das Gold der Literatur zutage förderten.‘ (MacShane in seiner Biografie von 1976, S. 428)
Was die Biografie Hineys neben der Lebensgeschichte Chandlers so ansprechend vermittelt, ist der zeitgeschichtliche Hintergrund, der einen die Romane um Philip Marlowe noch einmal anders lesen lässt. Die Zeit der Prohibition (1920 – 1933), in der laut Chandler mehr getrunken wurde als je zuvor (siehe dazu auch die Seiten 66 ff), der Ölboom in Kalifornien, dann 1927 der große Korruptionsskandal um die Julian Petroleum Corporation, bei dem Tausende von Anlegern um ihre Ersparnisse gebracht wurden.
Man versteht nach der Lektüre dieser Biografie besser, warum es in den Marlowe-Krimis von korrupten Polizisten wimmelt. Nicht nur das viel zu rasche Bevölkerungswachstum ist für die steigende Kriminalitätsrate in Los Angeles verantwortlich. Die Polizei ist für ihre Gewalttätigkeit berüchtigt und bei den rassistischen Ausschreitungen der Zoot Suit Riots von 1943 werden die Opfer bestraft, nicht aber die Täter. Das organisierte Verbrechen wird wohlwollend geduldet und gedeiht unter den Augen der Polizei ganz prächtig.
In 1937, a federal grand jury investigation discovered that no less than 600 brothels and 18,000 unlicensed bars were operating under the noses of LAPD officers. It also confirmed in its report that ‚a portion of the underworld profits have been used in financing campaigns of city and county officials in important positions … The District Attorney‘s office, Sheriff‘s office, and the Los Angeles Police Department work in complete harmony and never interfere with … important figures in the underworld‘. (S. 89)
Selbst der oberste Polizeichef von Los Angeles, James Edgar Davis, steckte in der Tasche der einflussreichen Wirtschafts- und Unterweltbosse.
Besonders interessant fand ich die Ausführungen zur Rolle der Filmzensur in Hollywood.
Drehbücher mussten nämlich vorab eingereicht und genehmigt werden, um allen möglichen und unmöglichen Bedingungen zu genügen. Ständig mussten Szenen umgeschrieben und Details verändert werden. Unter dem Einfluss der katholischen Kirche und weiterer sittenstrenger Verbände war 1934 Schluss mit der künstlerischen Freiheit, was Gewaltszenen, nackte Haut und bestimmte Themenstellungen anging. Diese Periode in der amerikanischen Filmgeschichte bezeichnet man als Pre-Code.
Doch ab 1934 wurde der Production Code für alle amerikanischen Filmunternehmen verbindlich. Dessen Regelungen zielten darauf ab, auch Kriminalität, Sexualität und politische Inhalte moralisch einwandfrei darzustellen. Eine treibende Kraft bei der Durchsetzung des Production Code war die katholische Kirche, die andernfalls mit Boykottaufrufen drohte, was jeden Film zu einem wirtschaftlichen Reinfall gemacht hätte. So mussten die Studios nicht nur die Drehbücher vor Drehbeginn einreichen, sondern auch Fotos beilegen, die zeigen sollten, wie lang die Kostüme der Schauspielerinnen waren. Am liebsten wurde es gesehen, wenn die Filme die Möglichkeiten des Mediums nutzen, der charakterlichen Erbauung des Zuschauers zu dienen. Auch die Wortwahl wurde überwacht, möglichst keine Flüche und so wenig Slang wie möglich. Helden durften nicht zu feminin wirken und es durfte nichts Kriminelles gezeigt werden, was man als Zuschauer vielleicht hätte nachahmen können. So wurde beispielsweise beanstandet, dass ein Verbrecher, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, im Film Handschuhe tragen sollte. Kein Wunder, dass sich da Chandlers Filme kaum werkgetreu verfilmen ließen… Erst 1967 wurde der Production Code abgeschafft.
Das letzte Kapitel setzt sich mit Chandlers Rezeption nach seinem Tod und mit seinem angeblichen Antisemitismus und seinem Rassismus auseinander.
Zum Abschluss meiner wieder völlig ausgeuferten Buchvorstellung ein Zitat des großen Kriminalschriftstellers:
I wish to God that Hollywood would stop trying to be significant […] because when art is significant, it is always a by-product and more or less unintentional on the part of the creator. (S. 166)
Als musikalischen Abschluss empfehle ich für diejenigen, die bis hierhin durchgehalten haben, Raymond Chandler Evening von Robyn Hitchcock and the Egyptians.
Anmerkung: Wer noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, dem lege ich die über 400-seitige Biografie von Frank MacShane ans Herz, die im Original erstmals 1976 und in der deutschen Übersetzung 1984 im Diogenes Verlag erschienen ist. MacShane geht stärker als Hiney auf die literarische Entwicklung Chandlers ein und beschäftigt sich mit den Ansprüchen des Autors, die dieser grundsätzlich an Literatur, an sein eigenes Schreiben und seinen Stil gestellt hat. Auch die Beziehungen zu seinen Verlegern, die ganze geschäftliche Seite seines Schreibens wird genauer referiert. Dazu zitiert MacShane ausführlich aus den Briefen Chandlers.